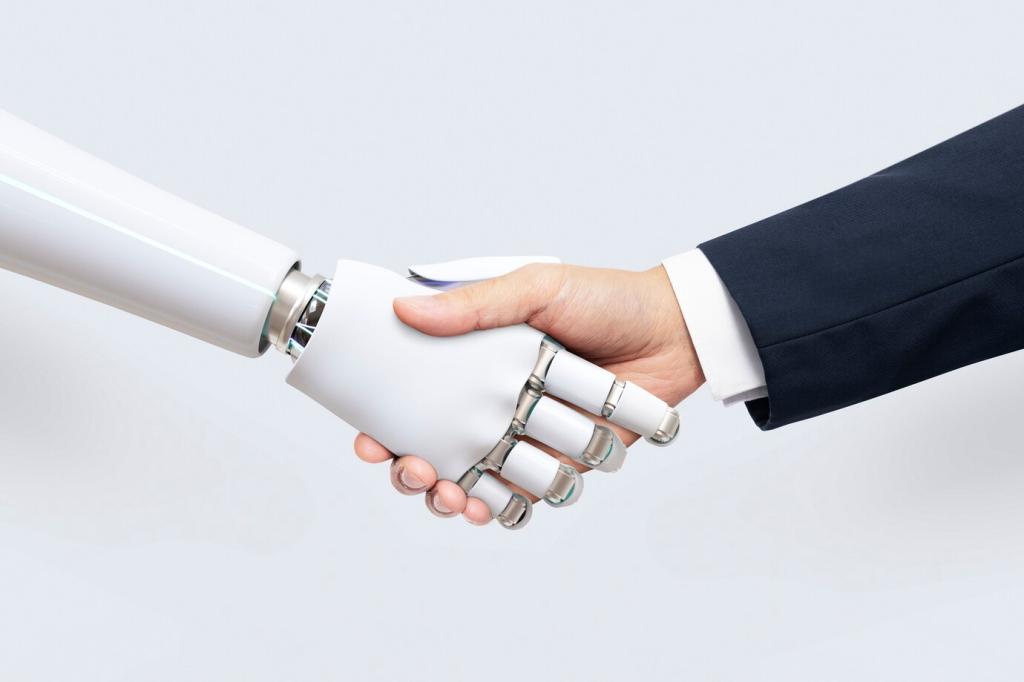Was bedeutet Bias in KI‑Algorithmen?
Bias in KI entsteht selten aus bösem Willen, sondern häufig aus Daten, die die Vergangenheit ungeschönt widerspiegeln. Wenn historische Ungleichheiten in Datensätzen stecken, lernen Modelle diese Muster nachzuahmen. So wird ein unsichtbares Erbe weitergetragen – oft unbemerkt, aber wirksam.
Was bedeutet Bias in KI‑Algorithmen?
Voreingenommenheit ist nicht gleich Zufall oder Rauschen. Bias bezeichnet systematische Verzerrungen, die bestimmte Gruppen benachteiligen können. Wichtig ist, Fairness nicht nur mathematisch zu definieren, sondern auch kontextuell zu verstehen: Welche Werte, Rechte und Folgen betreffen echte Menschen?